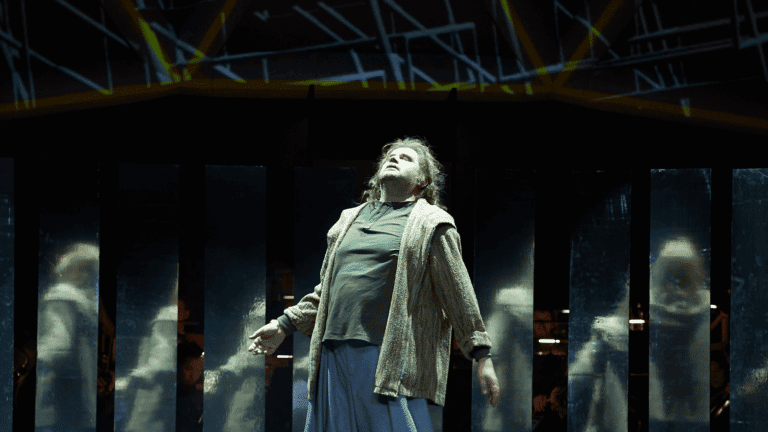Im Rahmen einer Reihe von Gesprächen zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes der Bundesrepublik sprach die Koblenzer Rhein-Zeitung auch mit Intendant Markus Dietze. Das Interview mit Kulturchef Claus Ambrosius erschien am 18. Mai 2024 in der Rhein-Zeitung. Mit freundlicher Genehmigung des Mittelrhein-Verlags veröffentlichen wir dieses nun am Geburtstag des Grundgesetzes, dem 23. Mai 2024, auch in unserem Blog.
1787 wurde das Theatergebäude in der Koblenzer Neustadt eröffnet, bis heute ist es Hauptspielort des Mehrspartenbetriebs der Stadt. Seit 2009 ist Markus Dietze dort Intendant – und sitzt derzeit quasi auf halb gepackten Koffern: Wegen der fortlaufenden Sanierung des historischen Theatergebäudes wird die kommende Spielzeit des Theaters schwerpunktmäßig in einem derzeit im Bau befindlichen festen Theaterzelt auf der Festung Ehrenbreitstein stattfinden, das Große Haus bleibt für diese Interimszeit für den Spielbetrieb geschlossen.
Wir sprachen mit Markus Dietze, der neben seiner Koblenzer Tätigkeit auch im Deutschen Bühnenverein, dem Bundesverband der Theater und Orchester, tätig ist, über die Freiheit der Kunst, die in Artikel 5 des Grundgesetzes verankert ist.
Claus Ambrosius: Herr Dietze, wir feiern in diesen Tagen 75 Jahre Grundgesetz – und damit 75 Jahre der darin fest eingeschriebenen Freiheit der Kunst. Als Theaterintendant vertreten Sie eine Kunstform, die vor mehr als 2000 Jahren in Griechenland eng verwoben mit der ersten Demokratie der Welt entstand. Und Sie vertreten immer wieder offensiv, dass Theater ganz in dieser Tradition als „Agora“, als zentraler Versammlungsplatz der Stadtgemeinschaft, auch eine gesellschaftliche und mithin politische Aufgabe hat. Wie lautet Ihr Urteil über die Wirksamkeit der Kunstfreiheit, wie sie unser Grundgesetz garantiert?
Markus Dietze: Nun, ich bin seit 2004 als Intendant tätig, zuerst am Theater der Altmark in Stendal in Sachsen-Anhalt, seit 2009 in Koblenz. Und ich kann sagen, dass in diesen 20 Jahren noch niemals ein Politiker oder ein anderes Mitglied der Legislative versucht hat, bestimmte Dinge inhaltlich zu fordern oder über finanzielle Vorgaben inhaltlichen Einfluss auszuüben. Viele haben versucht, finanziell Einfluss auszuüben – aber nicht, um etwas Inhaltliches zu erreichen.

Setzen wir einmal voraus, dass die Kunstfreiheit vor allem festgeschrieben wurde aufgrund der Erfahrungen in der Nazizeit, in der nicht nur der Einfluss des Staates auf die Kunst und ihr Missbrauch zur Propaganda stattfanden, sondern auch die Verführbarkeit von Künstlern sichtbar wurde. Wie genau schützt Sie heute die im Grundgesetz verankerte Kunstfreiheit vor staatlicher Einflussnahme?
In einer Situation wie in Koblenz ist das zunächst sozusagen betriebsverwaltungsintern: Es ist einfach nicht vorgesehen, dass ein anderer Teil der Verwaltung uns Vorschriften über unser Programm machen könnte. Auf der anderen Seite ist aber auch entscheidend, dass sich Theater bewusst sind – auch dann, wenn sie wie in Koblenz Teil eines Amts sind oder woanders als GmbH ebenfalls Teil der Exekutive –, wie wichtig es ist, eine gewisse Ferne zur politischen Repräsentation der Exekutive zu behalten. Denn dieser angesprochenen Verführbarkeit kann nur entgehen, wer auch ein bisschen einsam ist und nicht aus der bestehenden Regelung heraus eine gesellschaftspolitische Macht für sich reklamieren möchte.
Ihre Amtszeit in Sachsen-Anhalt ist schon einige Jahre her, seitdem hat sich die politische Landkarte verschoben und wird dies wohl noch weiter tun. Die Möglichkeit ist greifbar, dass wir in einigen Monaten über ganz neue Stimmverteilungen, wenn nicht gar Regierungsbeteiligungen der AfD reden – und über Entscheidungsträger in politischen Gremien, mit denen wir in der Bundesrepublik noch nie konfrontiert waren. Wie frei kann Kunst dann und dort noch sein?
Das verändert nichts an der grundlegenden Situation, wie wir sie auch im Moment vorfinden, wenn wir etwa über rechtsnationale Propaganda und den Umgang mit ihr reden. Es ist eigentlich ganz einfach: Jedem Versuch von Einflussnahme muss entschieden entgegengetreten werden. Man muss dann einfach sagen: „Das tue ich nicht, ich mache keinen Spielplan auf Ansage.“ Ob und wie erfolgreich das dann ist, wird davon abhängen, wie wir alle darauf achtgeben. Und wie immer funktioniert das natürlich nur mit einer wachsamen Zivilgesellschaft.
Nun wird es sich in diesem Fall aber um eine Zivilgesellschaft handeln, die eine Wahl durchgeführt hat, die genauso ausgegangen ist, dass diese Situation entstehen kann.
Richtig. Aber der entscheidende Punkt dabei ist, dass wir unterscheiden müssen zwischen Funktionsträgern antidemokratischer Kräfte und den Menschen, die diese antidemokratischen Kräfte wählen. Das ist eine Herausforderung, aber die müssen wir bewältigen. Dabei geht meiner Überzeugung nach die zentrale Gefahr unserer Zeit nicht davon aus, dass eine rechtspopulistische antidemokratische Partei aktiv Dinge tut oder fordert. Sondern davon, dass Parteien der bürgerlichen Mitte oder sogar bis ins Spektrum leicht links von der Mitte damit anfangen, aus populistischen Gründen die Narrative und Positionen neofaschistischer Parteien zu übernehmen, weil sie glauben, dadurch wieder mit den Wählern, die sie verloren haben, in Kontakt zu geraten – was jedoch nachweislich falsch ist. Es ist mir schleierhaft, wie man glauben kann, durch die Übernahme von rechtsradikalen Positionen Wählerinnen und Wähler für die bürgerlichen Parteien begeistern zu können, obwohl das demoskopisch und wissenschaftlich mehrfach widerlegt ist.
Solche Narrative spielten in der Vergangenheit gern mit einer Elitenfeindlichkeit – kann das mit einer Feindlichkeit gegen „unliebsame“ oder unbequeme Kunst Hand in Hand gehen?
Ich weiß nicht, ob das eine Elitenfeindlichkeit ist, ich würde es eher als eine Bildungsfeindlichkeit bezeichnen – und das ist besonders erschreckend. Es zielt auf eine grundlegende Angst vor Veränderung und auf die irre Annahme – das kann man auch nicht netter sagen –, dass in einer gefühlten Vergangenheit, die es so nie gegeben hat, das Leben irgendwie besser gewesen sei. Es gibt eine sehr aufschlussreiche Untersuchung zum Lebensstandard des durchschnittlichen DDR-Bürgers. Dieser war auch unter voller Anrechnung der veränderten Lebenshaltungskosten, der Inflation und aller weiteren Faktoren geringer als der eines heutigen Bürgergeld-Empfängers. Und genau so ist es schlicht falsch, dass der Lebensstandard der Menschen im Westen Deutschlands jetzt schlechter wäre als in den 1950er- oder 1960er-Jahren.
So viel zur Zivilgesellschaft – wer außer ihr kann noch zum Schutz der Kunstfreiheit antreten?
Wenn wir über Kunstfreiheit reden, müssen wir unbedingt auch die Freiheit von Wissenschaft und Presse dazunehmen, die ebenfalls im Artikel 5 des Grundgesetzes festgeschrieben ist. Denn das gehört für das Selbstverständnis der Bundesrepublik grundlegend zusammen: Die Freiheit besteht eben auch darin, dass es der Kunst, der Wissenschaft und auch der Presse zusteht, politisch zu sein oder nicht. Und das bedeutet, dass uns keine staatliche Institution zwingen kann, uns politisch in die eine oder andere Richtung zu verhalten, noch es uns verbieten kann. Genau das war ja die Absicht der vielen Väter und wenigen Mütter unseres Grundgesetzes: die Wiederholung der Katastrophe, die Deutschland zuvor durchlaufen hat, wirksam und hoffentlich langfristig zu verhindern. Dazu wurden diese Freiheitsrechte unverbrüchlich ins Grundgesetz geschrieben, um auf breiter Basis einer staatlichen Gleichschaltung entgegenzuwirken. Und deswegen müssen Wissenschaft, Presse und Kultur auch gegenseitig aufeinander aufpassen. Ob das gelingt, werden wir sehen.
Bislang scheint das in Deutschland gut zu funktionieren – Beispiele anderer Art haben wir in den vergangenen Jahren mit Polen und Ungarn erlebt. Dort wurde auf Spielpläne konkret Einfluss genommen, auch durch Austausch unliebsamer Intendanten. Museen zur Zeitgeschichte wurden politisch auf Linie gebracht.
Da können wir doch sagen, dass die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes es uns gut beschert haben. Und es hilft uns natürlich auch der deutsche Föderalismus. Dazu möchte ich auf einen Punkt hinweisen, der wichtig ist, über den aber kommunalpolitisch immer nur unter dem Gesichtspunkt der Frage nach der Finanzierbarkeit diskutiert wird: den der Kultur als „freiwillige Aufgabe“. Dass Kultur eben keine Pflichtaufgabe der Kommunen ist, war eigentlich als eine Auszeichnung gedacht. Damit die Kommune sagen kann: „Wir machen das selbst freiwillig und nicht gleichgeschaltet. Die Bundesrepublik Deutschland darf uns nicht vorschreiben, wie wir unser Theater, unser Museum und unsere Volkshochschule fördern und betreiben wollen.“ Die Kommunen sollten stolz darauf sein, dass dies ihre freiwillige Leistung ist, weil das ihre Unabhängigkeit ausstellt. Dass das durch die Schieflage der Kommunalfinanzierung von Land und Bund insgesamt im Moment nicht sauber funktioniert und oft so behandelt wird, als sei mit dem Begriff „freiwillige Leistung“ unterschwellig gemeint, dass das ein Luxus sei und sie es eigentlich nicht finanzieren sollten – das ist dann eine ganz andere Debatte.

Dem Gedanken des Föderalismus entspricht sicher auch, dass es eben kein gesamtdeutsches Kulturministerium gibt, dem alles untergeordnet wäre – andererseits wird in der öffentlichen Diskussion oft kritisiert, dass „die Kultur“ in Deutschland keine große gemeinsame Stimme habe, sondern in einen vielstimmigen Chor aufgesplittet sei. Im Moment etwa gibt es eine Antisemitismusdebatte, in der oft die Forderung nach einer gemeinsamen Verortung „der Kultur“ geäußert wird.
Das ist eben extrem komplex – und Menschen können nun einmal mit Komplexität nicht so gut umgehen. Es gibt nicht „das“ deutschsprachige Theater, es gibt auch nicht „die“ Presse. Und das bedeutet im Angesicht einer gleichzeitig auf immer höhere Schlagzahl und immer stärkere Impulse getrimmten Debatte gerade auch in den sozialen Netzwerken, dass jeder einzelne Vorfall sofort hochgespielt wird. Und trotzdem muss man bei jedem Ereignis gründlich prüfen: War das jetzt ein Einzelfall? Oder gibt es ähnliche Fälle, die auf strukturelle Probleme hindeuten? Man kann eben nicht sofort generalisieren, und das ist sehr anstrengend für die Menschen. Ich bin trotzdem überzeugt, dass Vielfältigkeit immer Stärke ist. Noch dazu bin ich kein Freund zentraler Direktiven und Ansagen. Wir führen im Deutschen Bühnenverein regelmäßig Debatten, weil Einzelne fordern, man müsse jetzt aber dringend zentrale Direktiven zu den Themen X, Y, Z herausgeben. Aber das ist doch genau das, wovon wir reden, wenn wir sagen: „Freiheit bedeutet, dass es jetzt keine zentrale Direktive gibt.“ Zugegeben: Das ist extrem anstrengend, aber ich glaube, dass es in der freiheitlichen Gesellschaft funktionieren muss.
Insgesamt also hat die Verankerung der Kunst im Grundgesetz für Sie funktioniert? Man hätte es nicht besser machen können?
Ich glaube, für die Kunst, die Wissenschaft und die Presse hätte man das nicht besser formulieren können. Auch weil das Grundgesetz an dieser Stelle in einem Nachsatz, der gern vergessen wird, die entscheidende Schutzformel enthält: „Die Freiheit der Kunst und der Wissenschaft entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.“ Ich bin als Künstler frei – aber verfassungstreu muss ich immer bleiben. Und da ist dann alles drin, ausgehend von der Würde des Menschen reicht das bis zur Gleichberechtigung der Geschlechter und der Religionen. Und damit ist eigentlich alles Notwendige gesagt.
Das Gespräch zwischen Claus Ambrosius und Markus Dietze erschien zuerst in der Rhein-Zeitung vom 18. Mai 2024.